Im Labyrinth ausgestellt und im quadratischen Kartenformat zu kaufen sind die Bilder „365 Punkte“ und „365 Punkte + 12 gelbe Kreise“ aus dem Nachlass des Basler Künstlers Ruedi Reinhard (1940-2018).
Preis für eine Karte mit Couvert: 12 Fr.
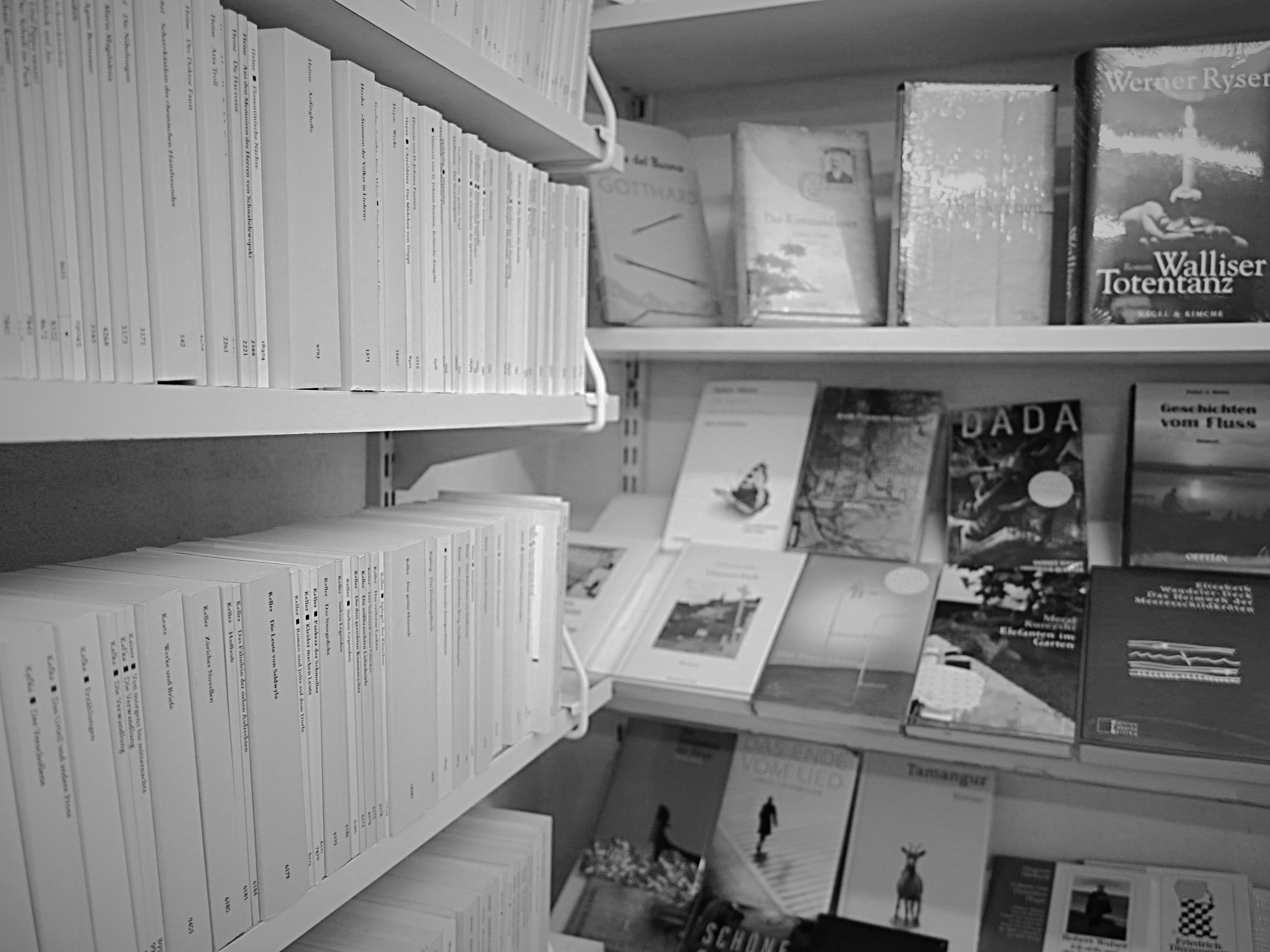
Im Labyrinth ausgestellt und im quadratischen Kartenformat zu kaufen sind die Bilder „365 Punkte“ und „365 Punkte + 12 gelbe Kreise“ aus dem Nachlass des Basler Künstlers Ruedi Reinhard (1940-2018).
Preis für eine Karte mit Couvert: 12 Fr.
Wir freuen uns, Sie über die Gründung des Vereins „Buch.Kultur“ informieren zu können. Ins Zentrum seiner Aktivitäten stellt der neue Verein die Freude am wissenschaftlichen Buch, die Lust zu Lesen und den Wunsch, sich über Literatur zu unterhalten. Und dieser Austausch hat bereits an Fahrt angenommen: Erste Buchbesprechungen sind entstanden, die Medien beginnen zu berichten, die Homepage ist im Werden und eine Reihe mit fünf wärmstens zu empfehlenden Veranstaltungen ist aufgegleist. Den Auftakt macht am 21. März der Tierphilosoph Markus Wild mit einem Abend zum Thema „Die Welt der Tiere – Neue Perspektiven„. Die Buchhandlung Labyrinth gratuliert allen Beteiligten zum vielversprechenden Projekt und freut sich auf eine angeregte und inspirierende Zusammenarbeit.
Der Verein „Buch.Kultur“ kann seine Ideen insbesondere dann umsetzen, wenn sich Menschen anschliessen und einbringen. Falls Sie buchbegeistert, literaturaffin, lesefreudig oder einfach neugierig sind, laden wir Sie ein, unten auf den Button zu klicken. Falls Sie möchten, können Sie sich gleich als Mitglied anmelden oder auch nur unverbindlich auf dem Laufenden gehalten werden. Sind Sie dabei? Wir freuen uns!
AnmeldenDer «Widerspruch» ist eine wichtige und konstante Stimme in der Diskussion für eine soziale und gerechte Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Seit über 40 Jahren beleuchtet der «Widerspruch» zweimal pro Jahr fundiert politische Zusammenhänge aus linker und emanzipatorischer Perspektive. In den verschiedenen Beiträgen wird eine Brücke geschlagen von theoretischer Gesellschaftskritik zu konkreten Kämpfen. Möglich gemacht wird die Zeitschrift durch ein unentgeltlich arbeitendes Redaktionskollektiv und auch durch Abonnent*innen.
Unabhängig – dank Förderabos!
Wer jetzt ein Förderabonnement des «Widerspruchs» für Fr. 150.- / € 100.- löst, erhält nicht nur die zwei neusten Hefte zugestellt, sondern auch ein Buch nach Wahl! Der Rotpunktverlag, der mandelbaum Verlag und die edition 8 stellen eine Auswahl Bücher zur Verfügung, aus der Sie eines auswählen dürfen.
Hier können die Bücher angesehen und das Abo abgeschlossen werden.
Die Buchhandlung Labyrinth wünscht dem «Widerspurch» weiterhin gutes Gelingen sowie zahlreiche neue Abonent*innen. Wir freuen uns auch im neuen Jahr auf eine inspirierende Zusammenarbeit.
Militärstrategen verdichten ihre Expertise häufig zu dem Satz, das erste Opfer jedes Krieges sei «bekanntermassen» die Wahrheit. Wer zur Quelle dieses Zitats gehen will, findet viele Väter, eine Mutter, mehrere Sprachen, unterschiedliche Datierungen. Orte, an denen die Wahrheit stirbt, sind Kampfzonen von Kompromat und Propaganda, wo Krieg nicht einmal Krieg heissen darf. Was stattdessen lebt, trägt Euphemismen wie «neue Realität» oder «alternative facts» und dient – der Geschichtsfälschung.
Doch wäre Orientierung an einer gemeinsamen, wahren Wirklichkeit überhaupt noch möglich in einer Welt von Fake News und Deep Fake, die als solche gar nicht mehr erkannt werden? Und trägt denn Fälschung als Technik nicht vieles zur Demokratisierung der (Marken-)Warenwelt bei? Kein Kunstmarkt ohne Beltracchis, liesse sich argumentieren. Höchste Zeit also – auch – für eine Verteidigung des Plagiats.
Im 18. Jahrhundert leistete sich Georg Christoph Lichtenberg den aufklärerischen Scherz, seine Leser und Leserinnen über einen Auktionskatalog zu informieren, dessen Unique Selling Proposition in der Bereitschaft bestand, das zu Gebot stehende Falschgeld aus Rücksicht auf die straffällige Klientel auch im Dunkeln zu verkaufen. Die Herbstausgabe der Zeitschrift wespennest hingegen will bei Licht betrachtet sein. Obschon auch darin vielleicht nicht alles ganz echt ist.
Die 183. Ausgabe des wespennests ist im Labyrinth erhältlich. Die Zeitschrift publiziert seit 1969 vierteljährlich, seit 2010 halbjährlich Texte internationaler Autorinnen und Autoren sowie literarische Neuentdeckungen.
«Was könnten wir tun, um Lech den Ruf von etwas Edlem zu verschaffen?» – «Tage der Philosophie! Philosophie und Berge, die haben sich schon immer gut vertragen.»
Die Antwort von Michael Köhlmeier war einfach, dennoch bedurfte sie zwei Jahre der ‘Reifung’, bis Konrad Paul Liessmann gefunden und dieser das ebenso einfache wie einleuchtende Konzept vorstellt: «Jedes Jahr ein Thema, und das wird in verschiedenen Vorträgen von verschiedenen Philosophinnen und Philosophen ausgeleuchtet. Das Konzept hat sich bis heute nicht verändert.»
Jedes Jahr ein Thema, «so zufällig wie signifikant» – das Philosophicum Lech spannt damit den Bogen über die Abgründe des Menschlichen.
Die Themen fordern zum Nachdenken auf – immer ist die Aktualität im Blick, zeitnah, selbstverständlich. Und immer verweigert das Nachdenken das Selbstverständliche, in dem Sinne, dass die Philosophin / der Philosoph gerade das, was selbstverständlich erscheint, «absolut nicht verstehen kann». Alle Bemühungen der Philosophierenden geht im Grunde dahin, unbedingt verstehen zu wollen. Das Zeitgemässe ist dabei der Stein, den die Verstehen-Wollenden den Berg hinauf zwingen, zu einer Hellsichtigkeit. Ernüchternd dabei ist, dass der scheinbare Moment einer Befreiung nicht die Freiheit von der Zeit bringt. Die Freiheit konstituiert sich vielmehr dabei, die Zeit in Gedanken zu erfassen. Der vielfach zitierte Satz von Hegel zeigt par excellence die Aufgabe der Philosophie. Das Philosophicum Lech hat ihn sozusagen verinnerlicht. – Das Buch über ein Vierteljahrhundert Vorarlberger Philosophie in der Herausgeberschaft von Konrad Paul Liessmann handelt nochmals die 25 Themen ab, in neuer Autorschaft, in neuer Zeitnähe.
Konrad Paul Liessmann: Der Geist im Gebirge. – Zsolnay Verlag, Wien 2022.
BESTELLENDer Tractatus Preis ist einer der wichtigsten Preise im Bereich der philosophischen Essayistik, der alljährlich vergeben wird. Die diesjährige Preisträgerin, Marie Luise Knott, ist eine profunde Kennerin von Hannah Arendt. In ihrem Preisträger-Buch versucht sie, Hannah Arendts politischer Position zum Rassismus auf den Grund zu kommen. Ausgangspunkt bildet dabei der Zufallsfund eines Durchschlag-Blattes einer Antwort von Hannah Arendt an Ralph Ellison im Zusammenhang ihres umstrittenen «Little-Rock-Aufsatzes». In ihrer Antwort kritisiert und widerruft sie ihre eigene Stellungnahme in der Auseinandersetzung um die schwarze Emanzipation.
Zugleich bestimmt die kritische Selbstauseinandersetzung wesentlich die Form des Essays. «Essays sind Exkursionen. In ihnen werden vorhandene Denkwege verlassen», ergänzt die Preisträgerin. Diese Haltung trifft auch auf ihren Essay zu. Haltung, Form und Inhalt sind die drei ‘Substanzen’, die den philosophischen Essay prägen.
Die Autorin ist sich bewusst, dass durch neue Kenntnisse und Untersuchungen «die tektonischen Platten unserer (westlichen) Gewissheiten» verschoben werden, Klassiker in Kritik geraten. So Hannah Arendt in Bezug auf Rassismus. Gleichzeitig blockiert ihr Eingeständnis ihre Verurteilung. Und die Nicht-Verurteilung wiederum öffnet für die Preisträgerin das Feld, die damaligen Schriften und Positionen von Hannah Arendt neu zu befragen – und zu verstehen. Und in diesem Anspruch folgt sie der Lebensaufgabe der Philosophin selbst: Verstehen zu wollen.
Marie Luise Knott: 370 Riverside Drive – 730 Riverside Drive. Hannah Arendt und Ralph Ellison. – Matthes & Seitz, Berlin 2022.
BESTELLEN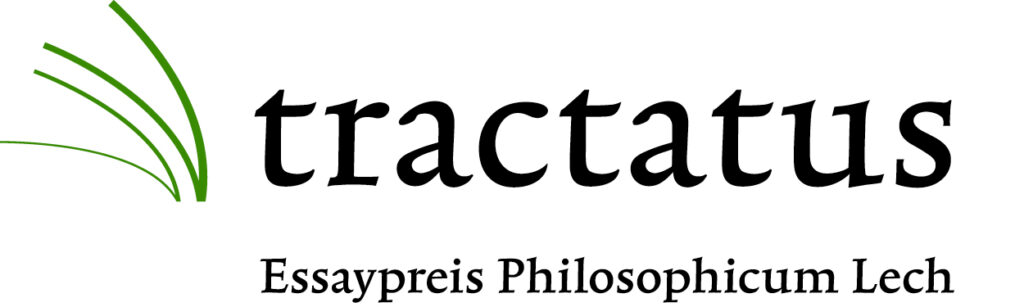
Eine Rezension von Julia Rüegger
„Warum ist gute – grosse – Literatur […] oft näher an der schlechten, misslungenen als an der soliden, perfekten, routinierten?“ S. 5
Welche Risiken geht man ein, wenn man über Figuren schreibt, die tatsächlich existiert haben?
Gibt es Geschichten, die nichts verfälschen?
Was hat „rücksichtslose Personenbearbeitung“ mit „Lebendigschreiben“ zu tun? S. 154
Beginnt das Fälschen schon beim Konstruieren eines Textes?
„Kann es Literatur geben, die naiv gelesen schlecht ist und raffiniert gelesen gut?“ S. 31
„Ist es nicht schrecklich, einen Schriftsteller zum Kind, Bruder oder Ex-Mann zu haben und von ihm in einen Roman gesteckt zu werden? “ S. 76
„Ist es […] überhaupt wünschenswert, erzählt zu werden, möchte ich der Gegenstand einer Biografie sein?“ S. 78
Gibt es eine Moral des Verschweigens?
„Was muss die Fiktion können, damit sie nicht enttäuscht, weniger ist als die Wirklichkeit, sondern mehr?“ S. 150
Und kann nicht auch die moralische Haltung eines Autors, einer Autorin zur Eitelkeit verkommen?
Diese und viele weitere tiefschürfende Fragen werfen Thomas Stangl und Anne Weber, zwei deutschsprachige Autor:innen, in ihrer Emailkorrespondenz auf. Beide wurden in den 1960er-Jahren geboren und setzen sich durch die Stoff- und Perspektivenwahl ihrer Werke regelmässig ethischen wie auch ästhetischen Herausforderungen aus. Zwischen 2014 und 2020 haben sie sich in zwei separaten Mailwechseln mit den Grenzgängen ihres Schreibens auseinandergesetzt und das weite, aber auch diffuse Feld zwischen Aufrichtigkeit und Schamlosigkeit ausgelotet.
Während der erste, kürzere Mailwechsel sich um die eher klassische Frage nach Kriterien für gute Literatur und deren moralischen Unterbau dreht, liegt der Schwerpunkt im zweiten Mailwechsel auf dem Umgang mit literarischen Figuren. Genauer: auf dem Umgang mit Figuren, wenn diese auf reale Personen zurückgehen, die entweder – wie bei den Expeditionsreisenden in Stangls Roman „Der einzige Ort“ – seit langer Zeit tot sind, oder – wie bei der von Anne Weber in „Annette, ein Heldinnenepos“ porträtierten Résistance-Kämpferin Anne Beaumanoir – noch leben. Dass aus dieser Betrachtung der eigenen Arbeiten keine Nabelschau erwächst, hat auch damit zu tun, dass Stangl und Weber eine Reihe anderer Autor:innen in ihre Reflexion miteinbeziehen und ihre Lektüren von Pierre Michon und Marguerite Duras, Jonathan Littell und Peter Handke, Franz Kafka und Ursula Krechel kontrovers verhandeln.
Wer aufgrund des Email-Genres einen süffigen Ton erwartet, wird vielleicht enttäuscht oder ratlos sein: Man sieht es dem Text nicht sofort an, dass er es vor allem als Fragenkatalog in sich hat. So gerät das Zwiegespräch zwischendurch etwas verkopft. Dennoch stecken die beiden Korrespondenzen voller starker und origineller Einsichten, gerade auch wenn das Gespräch aktuelle Themen wie Identitätspolitik oder Autofiktion berührt, sich diesen aber aus einem ungewohnten Winkel nähert. Am spannendsten und schönsten wird die Lektüre jedoch da, wo Stangl und Weber aus dem manchmal etwas zu rigide verfolgten selbstauferlegten Fragekatalog ausbrechen: da, wo sie einander widersprechen; wo sie zugeben, dass ihre eigenen Positionen immer wieder ins Wanken geraten; sie aber zugleich sehr präzise Worte finden, um all die Spannungen nachzuzeichnen, die den Schreibprozess zwischen künstlerischem Risiko und ethischem Anspruch ausmachen. Oder auch da, wo sie sich allen Zweifeln zum Trotz zu (vorläufigen) Bekenntnissen hinreissen lassen, die dann zum Beispiel so klingen:
„[…] dass die Form ihr Eigenleben hat, macht nicht nur gute Literatur aus, es macht auch jede Literatur angreifbar.“ S. 33
– Letzteres gilt wohl auch für diese im besten Sinne unruhig bleibende Korrespondenz.
Thomas Stangl, Anne Weber: Über gute und böse Literatur. Korrespondenz über das Schreiben. Matthes & Seitz 2022.
BESTELLENDas Innere einer Buchhandlung ist laufend in Bewegung. Wieder in die Regale verflüchtigt hat sich so auch unsere Auswahl an Büchern anlässlich des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Bücher sind jedoch nach wie vor sichtbar und dringend zu lesen. Denn weiterhin sind die Menschen in der Ukraine von der Gewalt und Vertreibung des Krieges betroffen, ihnen steht ein dunkler Winter bevor. Wir empfehlen nach wie vor, Autor*innen aus der Ukraine zu berücksichtigen und Antikriegsstimmen von überall zu lesen und zu hören. Es sind oft die engagierten Schriftsteller*innen, die mit ihrer Literatur erzählen, wovon sonst kaum berichtet wird und die auch dann noch schreiben, wenn die mediale Aufmerksamkeit nachgelassen hat. Neben den Büchern, die wir empfehlen, weisen wir auf weitere wertvolle Lesetipps hin:
Neuerscheinung – Tanja Maljartschuk: «Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus»
Diese Essays sind ein Geschenk: Sie öffnen ein Fenster zum Verständnis des Unvorstellbaren, das gerade in der Ukraine geschieht. Ergreifend und analytisch messerscharf stellt Tanja Maljartschuk dar, was die kriegerische Expansionspolitik Russlands mit einem Land und seinen Menschen anrichtet.
Zeitschrift – Lettre International: «Krieg in Europa»
Die Sommerausgabe der «Lettre International» trägt den Titel «Krieg in Europa» und enthält intensive Reportagen, inspirierte Essays und tiefschürfende Analysen zu dem von Putin entfachten Krieg. Übrigens ist nun bereits die Herbstausgabe der LI «Schein und Wahn» bei uns eingetroffen.
Social Media – Feminist Anti-War Resistance (auf Deutsch)
In Russland selber werden die verbliebenen Stimmen gegen den Krieg mit allen Mitteln unterdrückt. Doch es gibt sie! Besondere Aufmerksamkeit verdient die horizontale Initiative mit Graswurzelcharakter und queer-feministischer und antikolonialer Ausrichtung: «Феминистское Антивоенное Сопротивление» / «Feminist Anti-War Resistance». Seit dem 24. Februar werden über einen Telegram-Kanal unermüdlich Berichte über Aktionen verbreitet, Stimmen aus der Ukraine sichtbar gemacht, Tipps gegen Repression geteilt und Aktivist*innen miteinander vernetzt. Aus verschiedenen Ecken Russlands wird hier gegen den Krieg und gegen das Regime angeschrieben und gekämpft. Nun liegt der Chat ausschnittweise in deutscher Übersetzung vor.
Plakat – #НeтBoйнe #GegenDenKrieg
Von vielen wurde es schon gesichtet: Im Labyrinth hängt ein Soliplakat gegen den Krieg. Erreicht hat es uns durch einen Basler Spendenaufruf in Solidarität mit den anarchistischen, antiautoritären und (queer-)feministischen Aktivist*innen in der Ukraine, in Belarus und in Russland. Das Plakat kann gekauft werden, wobei der Erlös vollumfänglich dem erwähnten Spendenaufruf zugute kommt.

Die in Biel wohnhafte Autorin bewegt sich mit ihrem Werk an den Schnittstellen von Belletristik, Theater und Hörspiel. Mit ihren drei Romanen «Von wegen den Tieren» (2002), «Efina» (2009) und «Das unendliche Buch» (2014) erkundet sie mit grösster Sorgfalt verschiedene Stilmittel und Genres und behält dabei ihren kritischen Blick auf die Gesellschaft sowie ihren Humor bei.
„Die Schmalheit von Noëlle Revaz‘ Werk – sechs Bücher, davon drei Romane, in rund fünfzehn Jahren – hängt mit dem Anspruch zusammen, den sie an ihre Bücher stellt und der aus ihr eine der grossen zeitgenössischen Autorinnen französischer Sprache macht.“ (Aus der Jury-Begründung)
Nach Gertrud von le Fort (1952), Erika Burkart (1992) und Agota Kristof (2001) ist Noëlle Revaz die vierte weiblich gelesene Autorin, die den Gottfried Keller-Preis – eine der angesehensten und ältesten Literaturauszeichnungen der Schweiz – erhält.
Wir gratulieren der Noëlle Revaz zu diesem Preis und sind gespannt, wie sich ihr Werk weiterhin entfalten wird. Die bis zum jetzigen Zeitpunkt publizierten Bücher sind aktuell im Labyrinth ausgestellt – auf Französisch sowie in deutscher Übersetzung.
Sein 50-jähriges Bestehen feiert das Institut für Landschaftsarchitektur in Rapperswil (OST) mit einem historisch informativen Katalog, den die «Edition Hochparterre» wunderbar adäquat zu allen aufgeführten Themen gestaltet hat.
Die OST ist das einzige Institut in der Deutschschweiz, das «eine berufsbefähigende Landschaftsarchitektur- Ausbildung» anbietet. Praxisorientierte Lehre und Forschung führen zu engagierten Debatten über Krisen und drängender werden Zukunftsfragen. Von der Landschaftsplanung und -entwicklung im Sinne der Denkmalpflege über ökologische Forschungen bis zu architektonischen Visionen ist das Institut auch ein Ideenlabor. Zugleich betreibt es ein Archiv, das europaweit einzigartig ist.
Der Konnex zu Lucius Burckhardts «Spaziergangswissenschaften» liegt auf der Hand und verziert unsere Präsentation des empfehlenswerten Katalogs.
«Es handelt sich bei den Spaziergangwissenschaften um etwas ganz anderes als das traditionelle Flanieren. Sie sind eine Karikatur ihrer Vorbilder. Sie haben zwar deren Distanz zur Wirklichkeit geerbt, sie haben aber ihren nostalgischen Tenor verloren. Wir machen sie aus einer ironischen Haltung heraus. Denn heute kann man vieles nur so betrachten.»
Lucius Burckhardt geht also mit einem Objekt in die Landschaft, in die Stadt und konfrontiert damit sowohl diese Umgebung als auch deren Bewohner:innen oder eben Spazierende. Schlagartig verändern sich sowohl die Umgebung als auch der Blick auf sie oder aus ihr. – Bauprojekte, die in dieser Umgebung stattfinden sollen, werden mit etwas Ungewöhnlichem und Inadäquatem konfrontiert. Um diesen Aufruf geht es der Spaziergangswissenschaft.
Landschaftsarchitektur lernen – Geschichte, Gegenwart und Perspektiven.
50 Jahre Lehre und Forschung in Rapperswil.
Edition Hochparterre 2022.