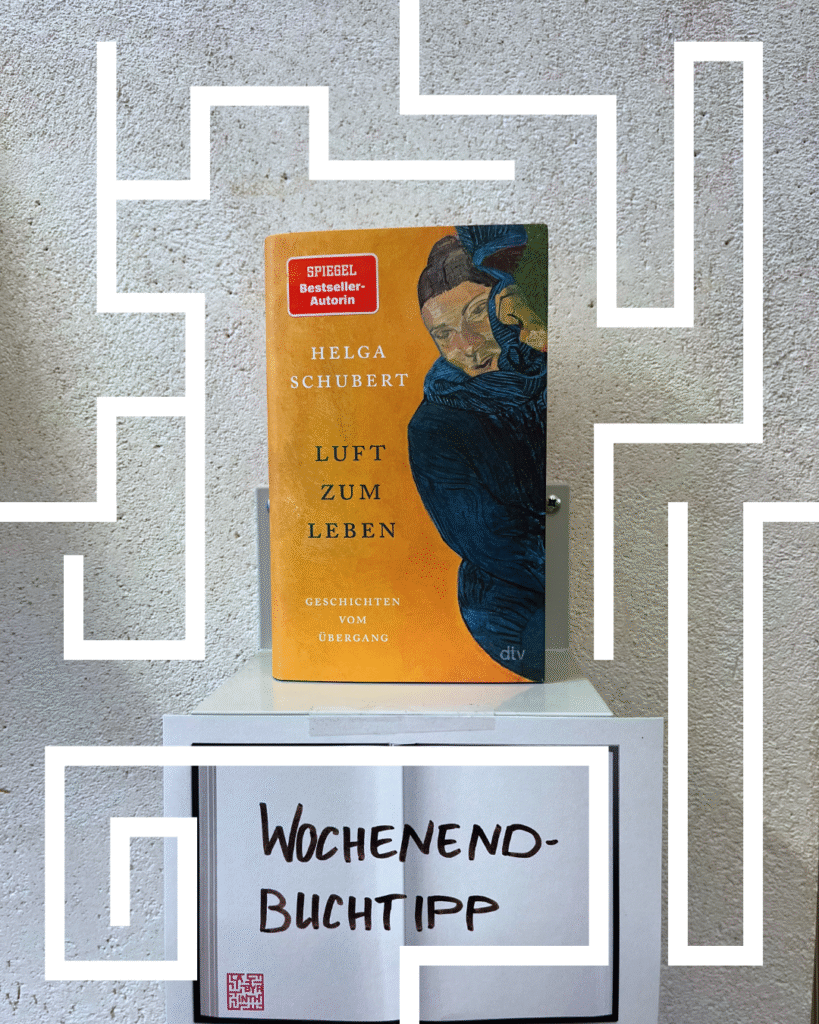Wir brauchen eine Stadt der Anerkennung, nicht der Verachtung, eine Architektur, die menschenfreundlich und einladend, nicht feindselig und abschreckend ist. Mit einem Wort: eine Architektur der Achtung. Eine, die sich als politisches Werkzeug dafür versteht, die Voraussetzungen für gesellschaftliche Anerkennung zu schaffen, indem sie unseren alltäglichen Umwelten eine Gestalt gibt.
Am Anfang von Mickaël Labbés 2019 im französischen Original und 2022 in der Übersetzung von Felix Kurz erschienen Buches Platz nehmen stehen zwei Befunde: Zum einen die Beobachtung, dass unerwünschte Personen mittels Architektur und Design zunehmend aus öffentlichen Räumen verdrängt werden, und zwar auf eine Weise, die ihnen unverhohlen vermittelt, dass sie keine erwünschten Bewohner*innen oder Besucher*innen eines Raumes sind. Diese Art defensiver Architektur, die sich z.B. in obdachlosenfeindlichem Mobiliar wie der «Camden Bench» zeigt, bringt einen feindlichen und verachtenden Raum hervor, der ein exklusives «Wir» von den unerwünschten «Anderen» unterscheiden soll. Zweitens konstatiert Labbé die damit zusammenhängende Beobachtung, dass die gegenwärtige Architekturszene sich hauptsächlich um ästhetische und technische Belange kümmert und dabei die eminent soziale, ethische und gesellschaftliche Aufgabe von Architektur verkümmern lässt – mit fatalen Folgen für das Gemeinwohl und den städtischen Raum als einen Raum der Vielfalt und Begegnung.
Dieser zweifachen Misere will Labbé, Professor für Philosophie an der Universität Strasbourg, mit Verve entgegentreten. Sein Buch ist ein Plädoyer für eine Architektur, die sich nicht länger als Luxusobjekt einspannen lässt, sondern sich wieder als eine Kunst versteht, die, mit Christophe Bailly gesprochen, «imstande ist, über die sachkundige Verwaltung des Gegebenen hinauszugehen und den Menschen einen Raum für ihr Zusammenleben zu geben» (175). Eine Architektur, die nicht jene neoliberale Idee von einer Stadt mitbefördert, die dem doppelten Imperativ von «Profitstreben und Angst» (86), «Verwertung und Ausschluss gehorcht» (91). Denn eine Stadt, die aus Imagegründen oder Marktinteressen Mittel der gezielten Vertreibung nutzt und so einen Raum der feindseligen Koexistenz schafft, sollte uns alle alarmieren, so Labbé: «Wenn eine Stadt bestimmte unerwünschte Gruppen abzuschrecken versucht – Obdachlose, Migranten, Jugendliche, Arme oder Mieter, die sich gegen ihre Verdrängung wehren – wird sie für uns alle unbewohnbar» (25).
In einer solchen Regierungsweise von Stadt, die in unserer neoliberalen Gegenwart immer weiter voranschreitet, steht nicht weniger auf dem Spiel als das 1968 von Henri Lefebvre proklamierte «Recht auf Stadt», das sich gegen einen Urbanismus richtete, der Menschen primär als produktive Arbeitskraft und Konsumenten in den Blick nimmt.Labbé konstatiert dieser Zeitdiagnose aus den 60ern eine traurige Aktualität: «Die seit Lefebvre unter der Losung ‹Recht auf Stadt› artikulierten Bedürfnisse wurden noch nie so systematisch und tagtäglich missachtet wie heute; die Versuche einer Wiederaneignung der Stadt durch ihre Bewohner sind praktisch vollständig gescheitert» (22).
Vor dem Hintergrund dieser düsteren Lage analysiert Labbé drei gegenwärtige Formen, in denen sich politische Bestrebungen, erneut Platz zu nehmen und sich die Stadt und den öffentlichen Raum wiederanzueignen, prominent manifestieren: die Platzbesetzungen, wie sie von Occupy Wall Street bis über die besetzten Verkehrskreisel der Gelbwesten reichen, die Protestcamps, die vor allem in Frankreich proklamierte «Zone à Defendre» (kurz ZAD) sowie zuletzt all jene Bewegungen, die sich der Neuerfindung eines «Recht auf Stadt» widmen.
Während Labbé den ersten beiden Formen zwar durchaus Erfolge und Potenziale zugesteht und sie, im Sinne einer demokratischen Revolte, grundsätzlich begrüsst, macht er zugleich deutlich, welche Probleme sie mit sich bringen. Sie würden den politischen Ort auf einzelne symbolisch besetzte Plätze und Zonen reduzieren, an Orte eines temporären Ausnahmezustands, und dabei jene Orte und Handlungsräume vergessen, die uns am nächsten sind, weil wir alltäglich in ihnen leben: Unsere Strassen, unsere Nachbarschaften und unsere Quartiere, samt Spielplätzen, Einkaufszonen und Hinterhöfen. Es seien aber, so eine von Labbés zentralen Thesen, genau diese Orte, an denen für eine Wiederaneignung des urbanen und sozialen Lebens gekämpft werden müsse. Ganz im Sinne von John Dewey, dem Philosophen des Pragmatismus, der betonte, dass eine demokratische Lebensform an Alltagsorten und im Zuhause beginnen müsse, fordert auch Labbé eine Neuorientierung unserer politischen Kämpfe: «Was das profane Leben in einem Viertel ausmacht, ist in gewissem Sinn ungleich bescheidener, dadurch aber zugleich ‹realer› als das Intermezzo einer kämpferischen Platzbesetzung oder die vollständige Neuerfindung unserer Existenzweisen in den ZADs« (131). Und einige Seiten später schreibt er: «Anstatt eine ZAD zu bevölkern, sollten wir die Orte unseres eigenen Lebens zu einer Zone à défendre machen» (136).
Zwar zeichnet Labbé, ein bekennender Liebhaber der Architektur, die zeitgenössische Zunft der Architektur manchmal etwas gar schwarz-weiss. Dezidiert politische Architektinnen wie etwa Gabu Haindl, die vehement an einer radikaldemokratischen Ausrichtung ihres Metiers arbeiten, kommen darin leider nicht zu Wort. Labbés Vorhaben, als politischer Philosoph das Gespräch mit Architektinnen und Stadtplanern aufzunehmen, um diese für den politischen Kern ihrer Arbeit zurückzugewinnen, und damit Allianzen gegen den vor Verachtung geprägten Ausverkauf öffentlicher Räume zu stärken, ist aber dennoch lobenswert – besonders in der heutigen Zeit, in der Mietpreisexplosionen und profitorientierter städtischer Wandel vielerorts Verdrängung und neue Segregationen hervorbringen, und damit eine eklatant «antidemokratische Logik der Raumproduktion» (79). Dass Labbé diese Prozesse nicht nur genau beobachtet, sondern sich auch traut, sie als pathologische Entwicklungen beim Namen zu nennen – als Akte unverhohlener Verachtung, die Menschen gezielt in ihrer Würde verletzten, sie degradieren und ausschliessen, was letztlich uns alle und unser Gemeinwohl als solches betrifft – ist ein besonderer Verdienst seines Buches.
Platz nehmen ist zwar deutlich «dem Erbe der Sozialphilosophie und der kritischen Theorie der Gesellschaft verpflichtet« (13), dennoch ist es gut lesbar und verständlich geschrieben. So nutzt Labbé sein theoretisches Wissen nie für langfädige Exkurse, sondern bleibt stets auf eine klare Argumentation konzentriert, für die er neben Axel Honneth, Michel Foucault und John Dewey auch die einflussreiche Stadt- und Architekturkritikerin Jane Jacobs oder zeitgenössische Philosophinnen wie Joëlle Zask zu Wort kommen lässt. Somit plädiert das Buch nicht nur für eine gesellschaftlich verantwortungsvolle Architektur, sondern auch für eine politisch engagierte Philosophie, die sich vom Elfenbeinturm heraus und auf die (Spiel-) Plätze bewegt, in die Fussgängerzonen und an sogenannte ‹Randgebiete›, an jene Orte also, an denen wir uns bereits alltäglich befinden und an denen wir von Neuem anfangen sollten, eine Stadt hervorzubringen, die ihre Bewohner*innen in all ihren Unterschiedlichkeiten willkommen heisst.
Rezension von Julia Rüegger
zum Buch: Mickaël Labbé: Platz nehmen. Gegen eine Architektur der Verachtung. Edition Nautilus 2022.