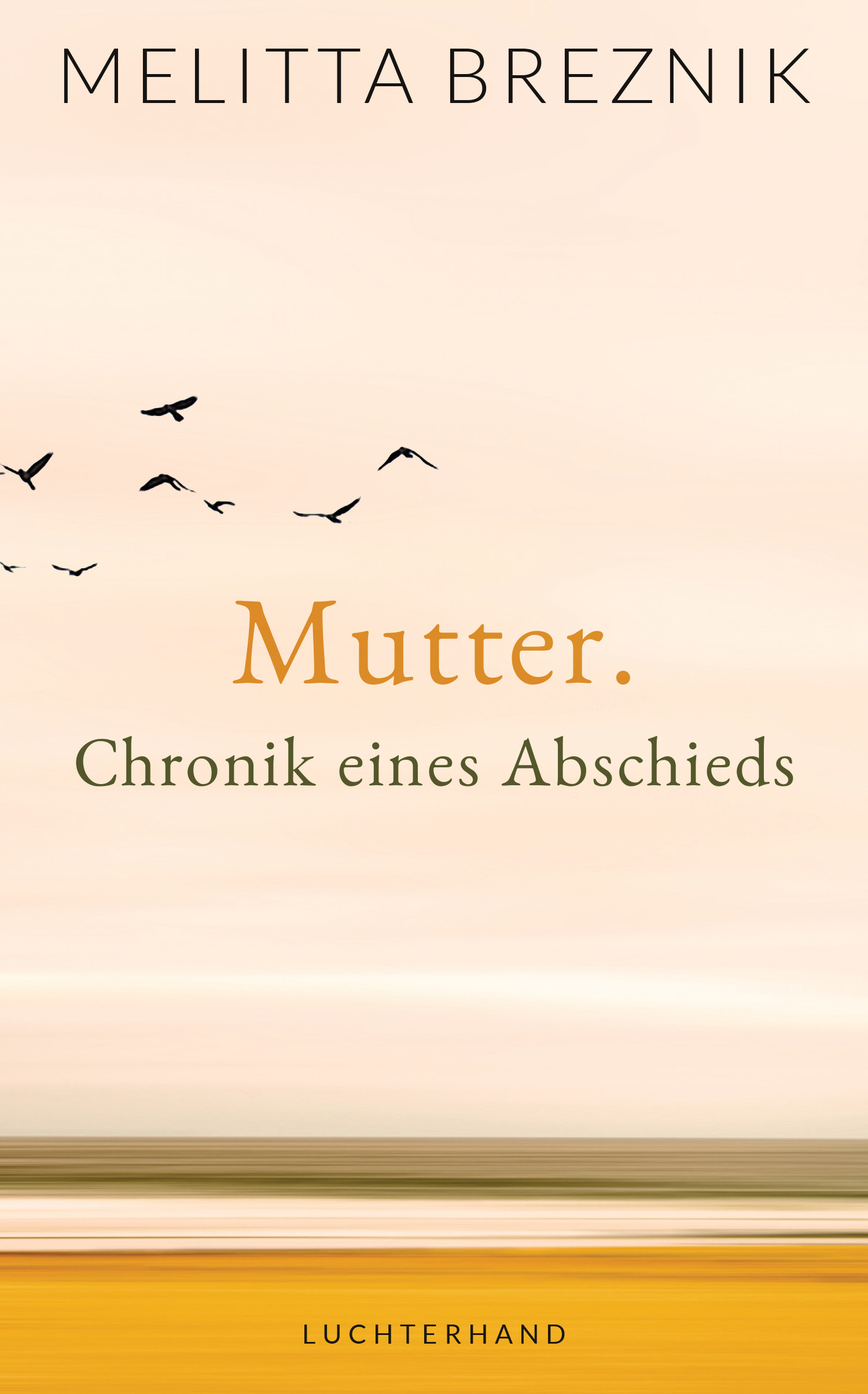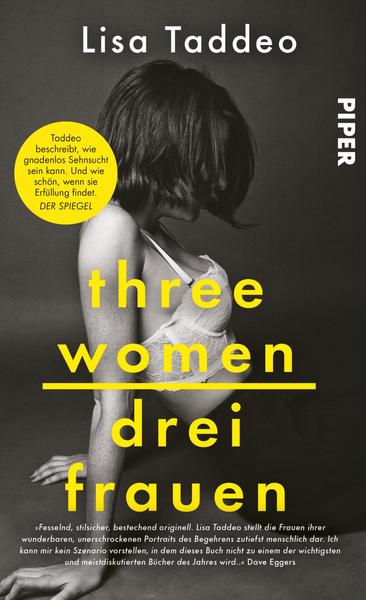Rotpunktverlag, Zürich 2020
Die romantische Sehnsucht nach der selbstbestimmten Stadt
Am 23. April 2020 wurde nach zwei Tagen Diskussionen im Grossen Rat von Basel-Stadt eine verwässerte Umsetzung der Wohnschutzinitiative vom Juni 2018 angenommen. Die Sozialdemokratische Partei, das Grüne Bündnis und der Mieter*innenverband Basel kündigten unmittelbar darauf ein Referendum an, da die Umsetzung ihrer Meinung nach nicht den Forderungen der von 61.9 Prozent der Stimmbevölkerung angenommenen Initiative entspricht. Die Annahme selbst war bereits eine willkommene Überraschung und zeigt, dass die Wohnungsnot mittlerweile in grossen Teilen der städtischen Bevölkerung angekommen ist. Oder zumindest auch jene, die sich bis anhin vor Mieterhöhungen und Massenkündigungen geschützt sahen, erkennen, dass die Wohnungskrise nicht vor dem sogenannten Mittelstand halt macht.
Eine etwas progressivere Ausprägung desselben Wandels zeigt sich in Berlin, seit Jahren ein Brennpunkt von Immobilienspekulation und Wohnungskrise. Die Enteignung, das ehemalige Schreckgespenst der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, ist mit der Bewegung „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Auch hier ist der Berliner Senat nicht so bewegungsfähig wie die Bevölkerung: einen Monat nach dem Basler Grossratsentscheid, am 18. Mai, reichte die Enteignungs-Initiative Klage gegen den Berliner Senat ein, weil die Prüfung des mit 77’000 Unterschriften eingereichten Volksbegehrens nunmehr bereits fast ein Jahr dauert.
Dass in Deutschland offen über Enteignung diskutiert und in der Schweiz per Initiative das „Recht auf Wohnen“ in der Kantonsverfassung Basels verankert wird, zeigt: die Wohnungsfrage hat eine neue Dringlichkeit erreicht. Doch das Problem ist keineswegs neu und so sind auch die Lösungen, die heute vorgeschlagen werden, bereits vielfach diskutiert worden. 1872/73 veröffentlichte Friedrich Engels seine Analyse der damals grassierenden Wohnungsnot als eine Replik auf eine Reihe von Artikeln in der Zeitung Volksstaat. Er kritisiert die Vorstellung, die Wohnungsfrage isoliert von den kapitalistischen Produktionsverhältnissen lösen zu können, da das Wohnen untrennbar mit unserer Vorstellung von Gesellschaft und mit den bestehenden Eigentums-, Produktions- und Arbeitsverhältnissen verbunden ist. „Erst durch die Lösung der sozialen Frage“, schreibt Engels (2015: 77), „wird zugleich die Lösung der Wohnungsfrage möglich gemacht. […] Zunächst wird aber jede soziale Revolution die Dinge nehmen müssen, wie sie sie findet.“
In diesem Sinne ist auch das Buch des Architekten und Städteplaner Ernst Hubeli, Die neue Krise der Städte, geschrieben, welches sich bereits im Untertitel als eine Aktualisierung von Engels’ Text zu erkennen gibt. Hubeli versucht, die Dinge, wie er sie findet, auszuloten und betrachtet dabei nicht nur die aktuellen Eigentumsverhältnisse am Wohnungsmarkt, sondern zunächst ganz allgemein die Vorstellung vom Wohnen in unserer Gesellschaft. Und die damit einhergehenden Träume vom Eigenheim, die in krassem Gegensatz nicht nur zur Realität einer Bevölkerung stehen, die zum überwiegenden Grossteil aus Mieter*innen besteht, sondern auch zur ökonomischen Realität. Denn in dieser geht mit dem Besitz des Eigenheims nicht Selbstbestimmung einher, sondern ein „Schuldenberg, der zum eigenen Gefängnis wird“ (S. 32). Das über Hypotheken finanzierte Eigenheim der Mittelklasse gliedert diese ins eigentumsideologische Geschäftsmodell ein, in die Armee aller Eigentümer*innen, die die Interessen der grossen Eigentümer*innen verteidigen soll. Die Subprime-Krise, die 2008 zur Weltwirtschaftskrise führte, machte freilich klar, dass die „Gemeinschaft der Eigentümer“ eine eingebildete war, deren Interessen letztlich vor allem institutionellen Grossanlegern dienten.
Hubeli erkennt darin ein Auseinanderdriften der Begriffe Wohnen und Gesellschaft, welches sich auch in den Wohnungen selbst offenbart, in der „Diskrepanz zwischen heterogenen Lebensformen und homogenen Wohnformen“ (S. 37–38). Im Segment der leistbaren Wohnungen führt das chronische Unterangebot zum Bau immer derselben, anachronistischen Raumkombinationen – „Wo Knappheit herrscht, ist alles begehrt.“ (S. 43) Und die Knappheit wird nicht weniger werden – seit Jahrzehnten ist die Zuwanderung zu den Städten konstant und aus der Gesamtoptik gibt es heute weltweit keine Alternative zu den Städten. Wie also ist die Stadt zu gestalten?
Zunächst ist diese Frage im Grunde nicht trennbar von der Wohnungsfrage. Allgemein kann gesagt werden: wichtig ist ein gesundes Stadtgefüge, das Richtungen festlegt aber weich genug ist, um sich seinen Bewohner*innen anzupassen. Hier gibt Hubeli einige interessante städtebauliche Betrachtungen und legt beispielsweise dar, wie mit Mikroverdichtungen in Baukostenmiete eine weitaus geeignetere Form der Wohnungsbeschaffung zur Verfügung steht als bei Wohnbauförderprogrammen für grosse Neubauprojekte in der Agglomeration.
Es folgt ein Abschnitt des Buches zur Frage der Enteignung, um neuen, leistbaren Wohnraum zu schaffen oder zu erhalten. Am Beispiel Berlins zeichnet Hubeli die diskurshistorische Wende nach, die letztlich dazu geführt hat, dass in Berlin die Enteignung von grossen Immobilienfirmen mehrheitsfähig geworden ist. Daran schliesst sich die Frage an, in welche Hände die so dem Markt entzogenen Wohnungen überführt werden sollen. Ein solidarisches Wohnungswesen kann nicht einfach jenen gehören, die die Immobilien zufällig bewohnen, denn „ohne rechtlich bindende Gemeinwohlorientierung gibt es keine Pflicht zum sozialen Vermieten“ (S. 107). Ein Blickwinkel, unter welchem es sich lohnen würde, auch das hiesige Wohngenossenschaftswesen mit seiner Gemeinnützigkeit einmal näher zu betrachten. Die Enteignungsbestrebungen in Berlin haben den weiteren Vorteil, dass sie privaten Boden rekommunalisieren und daher der Spekulation entziehen würden. Das ist vor allem in innerstädtischen Lagen relevant, wo die Bodenpreissteigerung ein Vielfaches mehr an Rendite verspricht als die Mieteinnahmen, was zu unbewohnten Luxuswohnungen in Stadtzentren führt, die lichterlos auf ihre Wertsteigerung warten. Neben einem mittlerweile in Berlin eingeführten Mietendeckel, der den Markt automatisch entlastet, spricht sich Hubeli hier auch für eine hohe Besteuerung von Bodeneigentum aus, dessen Wertzuwachs Eigentümer*innen heute leistungsfrei abschöpfen.
Der letzte Abschnitt des Buches trägt den Titel „Aneignung,“ und versucht das Wesen des Wohnens zu ergründen, das als Grundlage für eine geistige Rückeroberung der Städte dienen soll. Der Abschnitt enthält eine Fülle an Verweisen, von Lukács „transzendentaler Obdachlosigkeit“ zu Netflix’ Reality-TV-Show „Aufräumen mit Marie Kondo“ und ist etwas schwerer zu fassen als die Kapitel, die sich konkreteren Beispielen widmen. Dennoch macht es eine der grossen Stärken des Buches deutlich: Hubeli ist als Autor nie nur Architekt oder nur Städteplaner; er ist in seinen Ausführungen immer auch Soziologe und Philosoph. Das macht sein Buch auch dann interessant, wenn es bereits Bekanntes zusammenfasst und verleiht dem Text eine Spannung, die grundsätzlich anhält, wenngleich sie in den verschiedenen Abschnitten unterschiedlich ausgeprägt ist. Durch diese Art zu schreiben und zu denken wird Hubelis Buch mehr zu einer Streitschrift als zu einer Analyse. Und es gibt den Leser*innen Denkanstösse, die sich nicht im Bereich der Realisierungschancen, im gesetzlich oder ökonomisch Machbaren aufhalten, sondern die die Stadt und das Wohnen in einem offeneren, poetischen Rahmen denken lassen. Oder in Hubelis Worten: „Die romantische Sehnsucht erhellt die Grenzen der Vernunft. Sie stellt den ungebrochenen Glauben an das Machbare und Beherrschbare infrage; das Vernünftige wird gewissermassen verunreinigt, kommt zu sich selbst und kann sich verweltlichen.“ (S. 127)
Jürgen Buchinger